
Kinogucken
Der Drogenboss von nebenan
- Ein Blick auf die Täter – “Der Hauptmann” ab 15. März im Kino - 9. März 2018
- Eskalation! – Darren Aronovskys “mother!” - 15. September 2017
- Kinoküche #2: Mit der Co-Autorin von “Einmal bitte alles”! - 26. Juli 2017
Ein guter Drogenboss trägt Rauschebart. Predigt die Werte der Familie. Lässt seine Feinde und hin und wieder auch Freunde unschön hinrichten. Und liebt natürlich seine Mama.
Viel mehr erfahren wir in Escobar: Paradise Lost, dem Debütfilm des Italieners Andrea Di Stefano, auch nicht über den ehemals reichsten Drogenbaron der Welt, den Kolumbianer Pablo Escobar. Was einem kleinen Etikettenschwindel geschuldet ist: Escobar, gespielt von Benicio Del Toro, ist zwar titelgebend und auch auf dem Filmposter überlebensgroß vertreten – die eigentliche Hauptfigur ist jedoch Nick (Josh Hutcherson), ein kanadischer Surfer Boy, der Escobars Nichte heiratet und so ins kriminelle Netz gerät.
Der Film beginnt in der Nacht vor Escobars Verhaftung im Jahr 1991. Escobar bittet Nick sein Vermögen in Sicherheit zu bringen und anschließend jemanden für ihn zu erschießen. Er sei wie ein Sohn für ihn. Rückblende: Nick kommt mit seinem Bruder ins Surferparadies Kolumbiens. Und um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen, müssen wir erst einmal durch eine endlose Einheimisches-Mädchen-verliebt-sich-in-den-Fremden – Geschichte durch.
Aber okay! Der Pate fängt schließlich auch langsam an. Und niemand beschwert sich, dass der bedrohlich-charismatische Godfather (hier halt Patrón) gar nicht so viel Screentime hat. Nur kann Der Pate an seiner statt mit einem Michael Corleone aufwarten, der eine immense Charakterentwicklung nimmt. Josh Hutchersons Figur bleibt hingegen völlig flach.
Nick ist nicht etwa fasziniert von der Macht, nicht geblendet von Ruhm oder Geld. Nick ist einfach nur doof. Erst läuft er glücklich durch die Gegend und erkennt den Drogenboss nebenan nicht (Nach einer Hinrichtung: „Das würde er niemals tun“). Und als er die „wahre“ Gestalt seines Onkels sieht, ist es natürlich lange zu spät. Nick bleibt den ganzen Film über der gute Weiße im verdorbenen Kolumbien. Wenn Escobar ihn bittet, jemanden umzubringen, weiß man die ganze Zeit, dass er es natürlich nicht tun wird. Es gibt keinen Konflikt in ihm, keine Schwächen, nichts, er ist am Ende genau derselbe, der er am Anfang ist.
Zugegeben: Als alles endlich ins Rollen kommt, macht Paradise Lost dann doch noch recht viel aus seiner öden Ausgangslage und schwachen Charakterisierung. Die Jagd auf Nick ist durchaus spannend, ein kolumbianisches Bergdorf eine schöne Kulisse fürs Finale. Benicio Del Toro darf noch ein paar nette Metaphern grummeln. Aber zu einer großen Geschichte wird’s dadurch leider auch nicht mehr.
Trailer:
(Escobar: Paradise Lost läuft in diesen Münchner Kinos, in Atelier und Monopol auch als OmU)

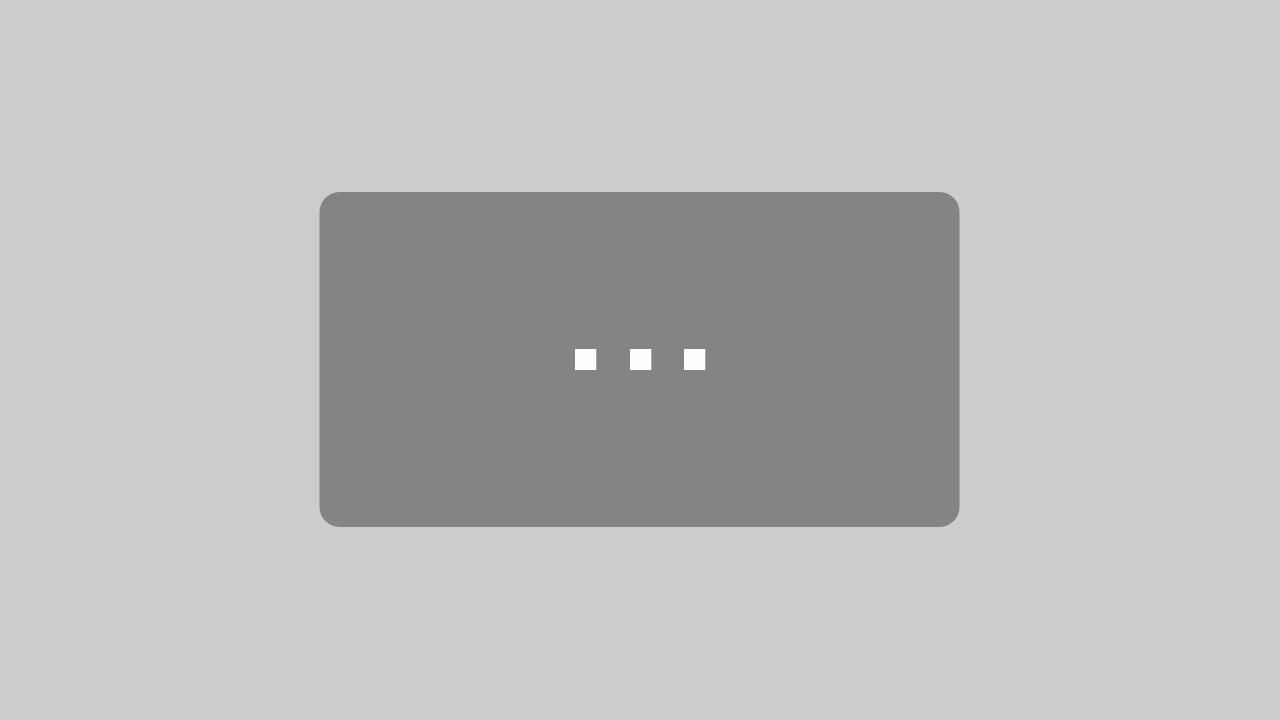




No Comments