Kultur, Nach(t)kritik
Nur Ferres fehlt noch
- Nur Ferres fehlt noch - 17. Februar 2011
- Eine Wagenburg für München - 12. Dezember 2010

Schwarze Ureinwohner, grünes Regenwaldparadies und eine weiße Familie mittendrin: Seit Donnerstag läuft „Dschungelkind“ in den Kinos, die Verfilmung des gleichnamigen, autobiographischen Buches von Sabine Kuegler. Die ist im Dschungel aufgewachsen und lebt heute in München.
Sehnsüchte sind manchmal so leicht zu erfüllen: Eine atemberaubende Naturkulisse, darin ein paar Schwarze mit Kriegsbemalung und mittendrin eine deutsche Familie, die den Ureinwohnern Vergebung beibringt. Die Sehnsucht nach solchen Szenarien hierzulande ist groß und darum wird nach dem Buch „Dschungelkind“ wohl auch dessen Verfilmung ein Erfolg werden.
Mit acht Jahren zieht Sabine mit ihren Eltern und Geschwistern in den Dschungel von West-Papua, wo ihr Vater die Sprache der weitab von Städten, Autos und Eiscreme lebenden Fayu erforschen will. Auf Eiscreme müssen die drei Kinder zwar schweren Herzens verzichten, zumindest Sabine fühlt sich aber bald wohl in der neuen Heimat und freundet sich mit den Gleichaltrigen an, lernt selbst die Sprache und schwimmt ausgiebig in dem Fluss, der sich malerisch am Haus der Familie vorbei schlängelt. Es gehört zu den wenigen erfreulichen Seiten des Films, wie die junge Stella Kunkat diese Sabine spielt: Offenherzig, begeistert und unvoreingenommen.
Unvoreingenommenheit ist ansonsten nicht Sache des Films, was durch und durch der Buchvorlage geschuldet ist. Sabine Kueglers autobiographisches Buch „Dschungelkind“ erschien vor sechs Jahren und war ein Bestseller, Grund genug für den umtriebigen Produzenten Nico Hofmann, das Ganze alsbald möglich auf die Leinwand bringen zu lassen. Um die absehbare Fernsehverwertung in der ARD kümmert sich deren Filmeinkäufer Degeto, der mit im Produktionsboot sitzt.
Am Set war die Buchautorin natürlich einige Tage vor Ort, um ihren Segen zu geben und Medienvertretern ließ sie gleich mal zwei Seiten über ihr Engagement bei der mit süßen Kinderbildern Mitleid und Spenden heischenden Organisation „World Vision“ zukommen. Von der Kritik an Kueglers „unsäglicher romantischer Verklärung von Ureinwohnern“, wie es die Gesellschaft für bedrohte Völker formulierte, ihrem völligen Ausblenden von Indonesiens Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen in West-Papua haben sich Hofmann und Co. nicht stören lassen.
Thomas Kretschmann spielt den Sprachforscher, bei dem man vergeblich nach dieser brennenden Leidenschaft für unerforschte Sprachen sucht, die ihn mit seiner fünfköpfigen Familie in einen der entlegensten Winkel der Welt pilgern lässt. Das tatsächliche Wirken von Kueglers Eltern als christliche Missionare und Bibelübersetzer spielt im Film keine Rolle.
Doch dort bringt auch so die deutsche Familie den abergläubischen Ureinwohnern, die keine Liebe und keine Vergebung kennen und sich darum ständig verstoßen und bekriegen, das bessere Leben bei. Auf dem Gipfel der ungebetenen westlichen Intervention beendet Vater Klaus den Krieg zwischen der Dorfbevölkerung und deren immer wieder mit Kriegsbemalung anrückenden Nachbarn; Titel dieses Kapitels: „Mein Vater und der Frieden.“
Keine Frage, dieser Film will keine politisch korrekte Dokumentation sein. Und es ist durchaus hübsch anzusehen, wie die Kamera zu erhabener Filmmusik über Baumwipfel, Täler und Berge des Drehortes im malaysischen Urwald hinweg schwebt. Nur, es wäre wünschenswert, dass Nadja Uhl lieber mal wieder in einem Andreas-Dresen-Film spielt, anstatt sich für solchen Ethno-Kitsch herzugeben und so den Deutschen zu suggerieren, das mit den Menschen, die weit weg und anders leben, sei alles ganz einfach zu verstehen.
Und wenn schon Kitsch, dann bitte richtig: Veronika Ferres hätte sich mit ihrem fragenden Mitleidsgesicht weitaus besser gemacht als die Mutter, die bei jedem verwundeten Fayu gleich mit ihrem riesigen Medizinkoffer losstürmt. “Dschungelkind“ ist nicht nur ein Film, der die Klischees von den Minderbemittelten dort und den Helfenden hier reproduziert, es ist ein langatmiger Film.
Regisseur Roland Suso Richter lässt Sabine ganze 132 Minuten heranwachsen und Abenteuer erleben – die Geschichte ihrer tragisch endenden ersten Liebe kann nicht verhindern, dass der Film insgesamt eher Ereignisse aneinander reiht als eine eingängige, spannende Geschichte zu erzählen. Ihr Gang in ein Schweizer Internat im Alter von 17 ist der Vollständigkeit halber ans Ende gehängt. Wer will schon die innere Zerrissenheit einer jungen Frau, die grübelnd auf ihrem Internatsbett sitzt, sehen? Lieber gleich nochmal einen Schwenk in den Dschungel!


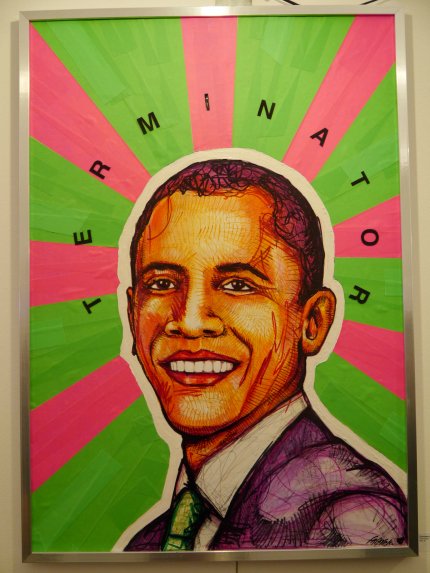

No Comments