
Kultur, Live, Nach(t)kritik
Aufschrei, Protest und Widerworte
- Aufschrei, Protest und Widerworte - 8. Mai 2010
- “Alles aus!” (Schon wieder…) - 30. April 2010
- Geschichten von Grenzen - 8. Februar 2010
Am Dienstag liest Iris Hanika aus ihrem neuen Roman “Das Eigentliche” in der Buchhandlung Lehmkuhl. Eine Rezension.

In der Mitte der Hauptstadt, heißt es im Roman „Das Eigentliche“, steht ein Gebäude, das Institut für  Vergangenheitsbewirtschaftung. In seinem Zentrum, im achten der sechzehn Stockwerke, befindet sich eine Maschine. Eine Maschine, die mit Geldscheinen gefüttert wird, damit sie die Kantinenkarte der Angestellten mit einem Wert auflädt, der sich gegen Essen eintauschen lässt. Allerdings spuckt die Maschine „jeden Schein, egal, welchen Wert er darstellt, viele Male wieder aus“, als behage ihr die Tätigkeit des Vergleichens nicht besonders, „denn eine solche Wertüberführung ist eine zu ernste Sache, als daß man dabei Fehler machen dürfte; es darf der jeweils zu übertragende Wert nicht erhöht, noch verringert werden.“
Derselben Schwierigkeit sieht sich der Vergangenheitsbewirtschafter Hans Frambach alltäglich gegenüber, wenn er die Datenbank mit den Nachlässen und Zeugnissen von Opfern der nationalsozialistischen Diktatur füttert. Der Computer freilich wehrt sich nicht gegen diese Überführung von Leben ins Archiv, Frambach aber wurde vom Unbehagen an der Normalität seiner Tätigkeit, an der Institutionalisiertheit des Gedenkens ergriffen. „Aus dieser Arbeit ist das Shoah-Business geworden. Und darin fühle ich mich fremd“, erklärt er seiner besten (und einzigen) Freundin Graziela, mit der ihn einst die Verpflichtung der Nachgeborenen einte, die aktuell jedoch allererst ihren Freund Joachim im Kopf hat. Hans sagt: „Mittlerweile komme ich mir mit meinem Pflichtbewußtsein wie ein KZ-Wächter vor, nur daß heute die KZ-Wächter dafür da sind, die Erinnerung wachzuhalten. Wir bewachen nämlich auch die KZs. Denn ohne KZs wären wir alle arbeitslos.“
Dass KZs heute keine KZs mehr sind, weiß Iris Hanika, die Autorin dieser Sätze, natürlich. Und dennoch hat ihr Frambach Recht – heißt man Auschwitz im alltäglichen Sprachgebrauch doch tatsächlich „KZ“ und eben nicht „Gedenkstätte“. Eine nüchterne, weiters unkommentierte Liste mit Beispielen ähnlicher Zynismen, die wir ähnlich gedankenlos akzeptieren, findet sich ziemlich genau in der Mitte des Buchs. Sie nennt unter anderem den Vorschlag, den Potsdamer Platz in „Judenplatz“ umzubenennen; den Leiter einer Gedenkstätte, der von einem ehemaligen KZ-Häftling schwärmt, er sei „besser als Primo Levi“; den Bioladen, der stolz verkündet, kein Obst aus Israel zu verkaufen; die Frau von der Wiedergutmachungsinstitution, die begeistert von ihrem Treffen mit der „Crème de la crème der Überlebenden“ berichtet.
An Hans Frambach dagegen führt Iris Hanika vor, wie es aussehen und wie es sich anhören müsste, wenn die Vergangenheit wirklich anwesend, wirklich konkrete Gegenwart wäre. Frambachs PC-Passwort lautet „Hoess“, beim U-Bahnfahren denkt er an die Züge in die Vernichtungslager, bei der Economyclass ebenfalls an die Enge in den Viehwaggons. Und dann schämt er sich dafür, dass er sich für die Obszönität solcher Vergleiche – Frambach nennt es Frivolität, das sei weniger abgegriffen – nicht mehr schämt. „Das war lange Zeit seine konkrete Not gewesen, der Auschwitzvergleich; daß der so absurd war, hatte sie verstärkt. Doch war diese Not eben irgendwann von ihm abgefallen.“ Was er davon halten soll, weiß Frambach selbst nicht, denn das ist die große Frage, die dieser Roman immer wieder neu, immer wieder anders stellt: Wie soll man das Unbegreifliche denn überhaupt noch begreifen? Jetzt, da es längst in den Beton der Mahnmale gegossen und zum Stoff von Unterhaltungsfilmen geworden ist.
Diese Frage stellt Iris Hanika dem Leser mit bewundernswert ungeschützter Hartnäckigkeit. Die NS-Rhetorik bricht sich immer wieder Bahn, so dass der Leser ihrer Literarizität schlichtweg nicht entkommen kann; wer gerade spricht bleibt dabei oftmals unklar. Das Erzählen ist manchmal von einem fast märchenhaften Ton historischer Distanz (Hans und Graziela klingt ohnehin beinahe wie Hans und Grete); in Klammern erfolgen ironische Seitenhiebe auf den Business-Slang des Instituts oder werden Assoziationen bibliografisch exakt verortet. Zu diesen regelrechten Interventionen ist auch eine Art Minidrama zu rechnen, das in vier Szenen die vier Phasen des bundesdeutschen Umgangs mit dem Holocaust mit teils groteskem, teils zynischem Strich nachzeichnet. Nur nicht Erstarren in einem Jargon der Eigentlichkeit, wenigstens stets auf der Suche sein nach der Möglichkeit einer fünften Phase des Erinnerns.
Immerhin weiß Hans Frambach, wie man das Unbegreifliche nicht begreifen wird. Auf einer Kirchenmauer liest er den Schriftzug „Golgatha Plötzensee Auschwitz Hiroshima Mauern“. Er nimmt sich das zugehörige Infoblatt – und ringt vor Wut um Luft. „Alle Verbrechen aller Zeiten, entnahm er diesem Text, waren einfach und zufriedenstellend zu erklären. Deswegen konnten sie ja so nebenbei aufgelistet werden.“ Dass man dem Sinnlosen immer einen Sinn abgewinne, erregt er sich später gegenüber Graziela, „das ist es, was mich fertigmacht“.
Der Sakralisierung von Auschwitz entgegen setzt Hanika weiße Seiten; gleich zweimal wuchert plötzlich eine solche Leere aus dem Buch. Das erste Mal steht sie für die Fassungslosigkeit, auch die des Lesers. Das andere Mal trägt sie die Überschrift „Raum für Notizen“: Frambach hat soeben ein paar Blätter eines Nachlasses gestohl-, nein: vor der archivarischen Ver-Wertung gerettet. Diese Privatisierung fordert Hanika anschließend auch von ihren Lesern, und ausnahmsweise erscheint es möglich, dass manch einer hier zum Stift greift, da es vielen leicht fallen wird, dieses Buch als unerhört abzutun. Denn das ist es vom ersten bis zum letzten Satz: eine so unglaublich wie buchstäblich unerhörte Zumutung, die einfach nicht aufhört, in den Ohren zu sausen und das Hirn zu martern. Ein Aufschrei, Protest und Widerworte dürften mithin ganz im Sinne der Autorin sein – dann nämlich wäre an das Gespräch, das „Das Eigentliche“ beginnt, angeknüpft, würde es fortgesetzt in die Zukunft, würde es nicht zum Ende kommen. Um die richtigen Worte zu finden, muss man sie schließlich suchen wollen.
Iris Hanikas neues Buch „Das Eigentliche“ ist soeben im österreichischen Droschl Verlag erschienen und kostet 19 Euro. Am Dienstag, den 11. Mai, liest die Autorin um 20.30 Uhr in der Buchhandlung Lehmkuhl (Leopoldstraße. 45). Der Eintritt kostet sechs Euro.
Diese ist Rezension von Katrin Schuster, der Macherin des Blogs literatur-muenchen.de (www.literatur-muenchen.de/), ist in der Maiausgabe des Münchner Literaturmagazins KLAPPENTEXT erschienen. Ein KLAPPENTEXT-Abonnement (www.literatur-muenchen.de/blog/mehrklappentext/ja-ich-will/) ist kostenlos.

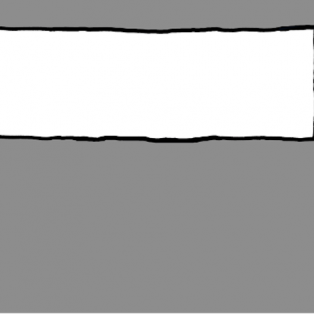


No Comments