
Aktuell, Kultur, Nach(t)kritik
Zwischen Warten und Wahnsinn – Medea im Volkstheater
- Zwischen Warten und Wahnsinn – Medea im Volkstheater - 28. November 2016
- “Am I touched for real?” Yael Ronens “Point of No Return” an den Münchner Kammerspielen - 31. Oktober 2016
- Hochspannung International: Der Krimi-Herbst 2016 - 23. August 2016
Medea ist wütend. So wütend, dass sie kaum zu zittern aufhören kann. Bis zum Wahnsinn verletzt. Denn Jason, ihr Ehemann, für den sie alles aufgegeben, ihre Heimat verraten und dem sie zwei Söhne geboren hat, verstößt sie, um eine andere zu heiraten. Dieser Abend von Jungregisseur Abdullah Kenan Karaca auf der großen Bühne des Münchner Volkstheaters ist ein Abend der Frauen. Ein Abend, der das Leben einer Frau im Patriarchat thematisiert, die sich aus Rache dazu entscheidet, ihre Kinder zu töten: ein Kabinett des Wahnsinns.
Vincent Mesnaritschs Bühne ist ein rechteckiger Kasten, der Einblick in einen kalten, abgenutzten Raum gibt. In der Mitte erinnern vier gelbe Sitze an das Warten in einer U-Bahnstation, an der hinteren Wand gibt eine Glaswand den Blick auf die männlichen Figuren des Abends frei. Kaum tauchen sie im vorderen Bereich der Bühne auf, nur Jason – grandios gespielt von Moritz Kienemann – wagt es, Medea in ihrem Gefängnis zu besuchen. Karaca hat das Personal der antiken Tragödie von Euripides auf das Wesentliche reduziert: Medea, verraten von Jason, wird von Gora zur Rache angefeuert und vom weiblichen Chor – hier einzig durch Mara Widmann repräsentiert, deren durch ein Mikrophon verstärkte Stimme sich über alle anderen erhebt – zu besänftigen versucht. Kreon, König von Korinth, verbannt Medea, ohne ihr nahe zu kommen, und nicht einmal der hilfsbereite Ägeus wagt es, Medea direkt gegenüber zu treten.
“Und du könntest wirklich deine eigenen Kinder umbringen, Medea?”
Die Rationale vorgebend, plant Medea ihre Rache an Jason und den Mord an dessen neuer Verlobten, der Prinzessin von Korinth, und deren Vater. Doch Jasons Zukunft zu zerstören genügt nicht: sein größter Schmerz, das weiß sie genau, wäre der Tod ihrer gemeinsamen Söhne.
Julia Richter, frischgebackenes Ensemblemitglied am Volkstheater, mimt Medeas Wahnsinn mit vollem Einsatz und einer beklemmenden Bühnenpräsenz. Jason, hier ein gestriegelter Unsympath mit weißen Turnschuhen und noch weißerem Gebiss, fürchtet sich sichtlich vor ihr – und behält ganz im Bilde der antiken Gesellschaft trotzdem die Oberhand, denn eine Frau ist hier Nichts ohne ihren Mann: “Von allen Wesen, die auf dieser Erde Verstand haben, sind wir Frauen doch die Ärmsten”, sagt Medea – bis sie am Ende doch als grausame Gewinnerin da steht, die das ihr Liebste tötet, um ihn zu zerstören: “Oh, hätte ich sie nie gezeugt. Ich müsste sie jetzt nicht erschlagen sehen.”

Zwischen Heimatlosigkeit und Verrat
Was macht den Medea-Mythos, der zur Zeit wieder vermehrt im deutschsprachigen Raum inszeniert wird, heute noch so interessant? Das ist natürlich nicht nur das psychologische Kammerspiel und die Tragödie der liebenden Medea, sondern auch ihre Fremdheit in Korinth. Medea ist eine Geflüchtete und aufs Neue eine Heimatlose, sobald Jason sie verlässt und Kreon sie seines Landes verweist.
“Tastet man mein Recht an, so werde ich mich wehren”, erzürnt sie sich, doch an diesem Punkt hat die griechische Gesellschaft ihr bereits jedes Recht abgesprochen. Und so treibt Karaca seine Inszenierung zu einem fulminanten Ende, dem stärksten Bild eines Abends, der unter die Haut geht: Medea und Jason verbleiben alleine auf den Stühlen, Trost beieinander suchend trotz ihrer Entzweitheit, als würden sie warten. Warten auf ein gemeinsames Gefühl, erneute Zweisamkeit oder auf das Glück, das nicht kommt.
Selten hinterlässt ein Stück durch ein einziges Bild einen solchen Eindruck.
Bilder: © Arno Declair


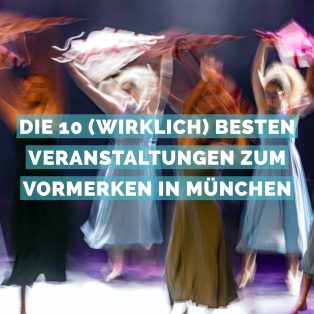

No Comments