
Gute Sache, Leben
“My mural here is bigger!” – OBEY-Schöpfer Shepard Fairey malt in München
- Leckt mich, Kellerkind und co., ich hassliebe euch! - 15. April 2016
- whitebox im Werksviertel: mehr als ein Ausstellungsraum - 13. April 2016
- BEATNIKBOY mit neuer EP: “Ja, wir brauchen Bass!” - 21. März 2016
Street-Art bewegt sich in einem neuen Spannungsfeld. Manche Künstler*innen malen nicht mehr illegal. Das stellt die Frage nach der Authentizität der Werke und welche Interessen dahinter stecken. Dieser Überprüfung muss sich eine Kunstform unterziehen, die selbst kapitalismuskritische Botschaften sendet.
Die Sonne strahlt und plötzlich ist er da: der Schöpfer von Obey Giant. Zuerst Street-Art-Legende. Dann weltweite Aufmerksamkeit dank einer Ikonographie von Barack Obama. Erfolgreicher Künstler und Grafik-Designer. Shepard Fairey ist auf den ersten Blick eher unscheinbar.
Dunkle Jeans, dunkles Shirt. Auf seinen Fingernägeln schimmert noch die getrocknete Farbe. Wer selbst schon mal gesprüht oder gemalt hat, weiß, wie hartnäckig die letzten Reste auf der Haut festsitzen. Fairey und sein Team waren fleißig: 190 Quadratmeter in zwei Tagen. Sie haben München ein Wandgemälde geschenkt.
In der Landshuter Allee 54 in Neuhausen streckt eine Hand den Passant*innen einen kleinen Eimer Öl entgegen: „Paint it black“. Plakative Schlagworte prangen auf der Front. Ironische Produktwerbung. Kritik verpackt mit den Mitteln des Kapitalismus. Die Vorlage stammt aus der Ausstellung „Power and Glory“, die die Vormachtstellung von Konzernen in der amerikanischen Politik und das Scheitern des American Dream behandelt hat. Fairey: „Indem einige Macht und Ruhm anhäufen, entsteht Leid und Erniedrigung bei vielen.“
Faireys typische Stilsprache spielt oft mit den Motiven und der imperativen Aussage früherer Propagandaplakate. Hier will er ein Zeichen für regenerative Energien setzen, denn Öl schadet nicht nur der Umwelt, es hat auch zu viel Kontrolle. Wenn der Künstler von seiner Arbeit erzählt, gewinnt er an Präsenz – die Gesten der farbbespritzten Hände untermalen seine Botschaft.
 Street-Art findet im öffentlichen Raum statt. Die Künstler*innen nutzen den unbeschränkten Zugang zu den Straßen, um direkt mit dem Publikum zu kommunizieren. Indem sie öffentliche Flächen als Medium betrachten, werfen sie die Frage auf: „Wem gehört die Stadt?“ Street-Artists behaupten: uns, den Bürger*innen. Der Akt des Schaffens befindet sich oft in einem unklaren Grenzbereich: hier moderne, unkonventionelle Kunst mit ästhetischem Wert, dort Ergebnis illegaler Nutzung fremder Flächen und damit Vandalismus.
Street-Art findet im öffentlichen Raum statt. Die Künstler*innen nutzen den unbeschränkten Zugang zu den Straßen, um direkt mit dem Publikum zu kommunizieren. Indem sie öffentliche Flächen als Medium betrachten, werfen sie die Frage auf: „Wem gehört die Stadt?“ Street-Artists behaupten: uns, den Bürger*innen. Der Akt des Schaffens befindet sich oft in einem unklaren Grenzbereich: hier moderne, unkonventionelle Kunst mit ästhetischem Wert, dort Ergebnis illegaler Nutzung fremder Flächen und damit Vandalismus.
Hinzu kommt die vermittelte Botschaft, die einen ausdrücklich politischen Charakter innehat. Die Künstler äußern Kritik an bestehenden Verhältnissen, auf die sie die Gemeinschaft hinweisen. Das Internet hat die Straßen einer Stadt zu globalem Gemeingut verwandelt und in den letzten Jahren hat der Großteil der Bevölkerung Street-Art als Kunstform anerkannt, wodurch neue Probleme aufgetreten sind: Mit der eigentlich unveräußerlichen Kunst lässt sich Geld verdienen.
Manche Größen der Szene verweigern, ihr Schaffen in Einkommen umzusetzen. Andere, darunter Fairey, sehen keinen Widerspruch darin, Street-Art wie andere Kunstformen auch einer Nachfrage zu öffnen. Hat der Diskurs früher vor allem zwischen Kunst und Verbrechen seinen Rahmen gefunden, findet er aufgrund der gesteigerten Aufmerksamkeit heute zwischen Kunst und Kommerz statt.
Positive Propaganda in der Stadt
Dem Mann neben Fairey sieht man die Leidenschaft in den Augen an, während er redet. „Positive Propaganda“ hat Sebastian Pohl seinen Kunstverein genannt. Er verfolgt das Ziel, die Bevölkerung Münchens in den Genuss von Street-Art zu bringen. Dafür begibt er sich in die Mühlen der Bürokratie und arbeitet an der Bereitstellung öffentlicher Flächen: „An dieser Wand bin ich seit 2008 dran.“ Seine Freunde aus der Szene verschönern sie dann mit gewaltigen Gemälden.
Seine Freunde sind namhafte internationale Künstler*innen, die politische Kunst machen. Jedes Bild soll Denkanstöße liefern, die Betrachter*innen bestenfalls zu einer politischen Auseinandersetzung anregen. Das ist Pohls Agenda. Diesmal hat er also Fairey in den Flieger gesetzt. Zur Veröffentlichung seines Werks ist sogar der zweite Bürgermeister Josef Schmid gekommen, der im Hintergrund Überzeugungsarbeit für das Projekt geleistet hat. Er weiß um den Status des Gasts und rechnet ihm seinen Beitrag für die Kulturstadt München hoch an.
Der künstlerische Leiter steckt viel Herzblut in seinen gemeinnützigen Verein, der sich über Spenden, Förderungen und ehrenamtliche Arbeit finanziert. Oder aus der eigenen Tasche. So hat Pohl die Farbe selbst bezahlt und auch die Fläche im Voraus grundiert. Fairey verzichtet auf eine Gage und hat die Kosten seines Teams übernommen, ist aber allein über die Möglichkeit glücklich; keine Selbstverständlichkeit, schließlich könnte er in derselben Zeit Aufträge annehmen. Das Kulturreferat ist für Flüge, Unterkunft und die Hebebühne aufgekommen. Das stellt normalerweise keine Basis für solche Aktionen dar.
Deshalb bemüht sich Schmid inzwischen um eine institutionelle Förderung beim Kulturreferat, denn die bisherigen Mittel decken noch lange nicht die Kosten. „Ungefähr zehn Prozent“, sagt Pohl. „Positive Propaganda“ soll mit einem jährlichen Beitrag eine bessere Arbeitsgrundlage geboten werden. Die Politik wolle sich so weit wie möglich raushalten, um der Kunst den nötigen Freiraum zu sichern und vertraut auf den Kurator und sein Netzwerk. An ihm schätzt Schmid den riesigen Idealismus, dem die Stadt solche Kunst verdanke.
 Pohl und Schmid verstehen sich gut, profitieren doch beide von der Zusammenarbeit. Der eine holt Künstler von Weltrang in die Straßen, der andere hilft, öffentlichen Raum zurückzugewinnen. Deshalb lobt Schmid den Projektleiter, der „Stadt des Geldes und der Hochglanzkultur“ zu etwas mehr Coolness zu verhelfen. Seine moderne Weitsicht setze Kontrapunkte und stoße Dinge an, die anders sind. Als der Politiker Fairey den Wettkampf zwischen München und Berlin erklärt, ergreift dieser sofort Partei: „Mein Mural hier ist größer!“
Pohl und Schmid verstehen sich gut, profitieren doch beide von der Zusammenarbeit. Der eine holt Künstler von Weltrang in die Straßen, der andere hilft, öffentlichen Raum zurückzugewinnen. Deshalb lobt Schmid den Projektleiter, der „Stadt des Geldes und der Hochglanzkultur“ zu etwas mehr Coolness zu verhelfen. Seine moderne Weitsicht setze Kontrapunkte und stoße Dinge an, die anders sind. Als der Politiker Fairey den Wettkampf zwischen München und Berlin erklärt, ergreift dieser sofort Partei: „Mein Mural hier ist größer!“
Pohl hat den CSU-Mann seit der ersten Begegnung „begeistert und authentisch“ erlebt; keiner, der die Inhalte für sich selbst instrumentalisieren wollte, sondern anpackt und ermöglicht. Schmid erzählt über seinen persönlichen Zugang zu Street-Art und politischer Kunst: „Ich habe schon immer gern Bilder angesehen, die mir irgendwo begegneten. In München ist vieles gut und toll, aber es darf auch etwas unruhiger und kritischer sein. Wir können nicht nur Maximilianstraße, sondern auch Landshuter Allee. Ich stimme nicht immer zu, aber Kunst muss zum Nachdenken anregen und Diskussionen provozieren.“ Legale Street-Art ist mitten in der Gesellschaft angekommen.
Street-Art und Gentrifizierung
Fairey freut sich, eine so große Fläche erhalten zu haben, was nicht einfach ist. Der Location kann man nicht nachsagen, stark besucht oder gar ein Touristenmagnet zu sein. Von der Straße ist das Werk sogar nur aus einer Richtung zu sehen, es ziert die seitliche Fassade eines Gebäudes der Stadtwerke.
Street-Art kämpft seit ihrer Ankunft in der breiten Öffentlichkeit mit einem Problem. Einerseits beansprucht sie, für alle da zu sein und oftmals auch Kritik an Herrschaftsverhältnissen zu üben. Auf der anderen Seite haben manche Künstler so viel Ansehen erworben, dass ihre Werke der Öffentlichkeit teils gewaltsam entrissen werden. Oder die Bilder sorgen ungewollt für einen Gentrifizierungsschub in ihrem Umfeld, wodurch Anwohner*innen mit wenig Einkommen aus ihrem Kiez vertrieben werden. Die Kommerzialisierung von öffentlicher Kunst bietet viel Diskussionsstoff. Die Örtlichkeit ist daher auf doppelte Weise interessant.
Zuerst werden Bedenken zerstreut, die Stadt wolle nur etwas für ihre Außenwirkung tun. Ob man nicht vielleicht einen prominenteren Ort zur Verfügung hätte stellen können, wird Schmid gefragt, weil eben doch nicht so viele Leute vorbeikämen: „Es gibt gar keinen besseren Ort.“ Das Thema habe Vorrang. Pohl beweist mit seiner bisherigen Standortwahl, dass er die Ortsansässigen ansprechen will. Es geht ihm darum, den Anwohner*innen einen Zugang zu verschaffen, nicht Touristen eine Möglichkeit für Selfies in der Innenstadt zu bieten.
Natürlich profitiert der Ruf der Stadt dadurch, einen Künstler dieser Klasse sich hier verewigen zu lassen. Dennoch steht der gemeinnützige Zweck einer öffentlichen Wand im Vordergrund. Dafür setzt sich Pohl grundsätzlich ein: „Es ist nicht unsere Aufgabe, Privateigentum aufzuwerten.“ Fairey hat auch deshalb ohne Bezahlung gearbeitet, weil ihm eine Fläche zur Verfügung gestanden ist, die allen gehört, und keine inhaltlichen Vorgaben gemacht worden sind.
Außerdem lässt sich die Botschaft des Bilds mit seiner Umgebung verbinden. Fairey gefällt es, dass ein öffentliches Unternehmen als Leinwand gedient hat, das auf erneuerbare Energien baut. Das betont auch Bürgermeister Schmid. Die Stadtwerke München versorgen alle Privathaushalte und den öffentlichen Nahverkehr mit Ökostrom. Bis 2025 sollen auch Unternehmen in diesen Genuss kommen. Passend: Die Sicht wird von einer Ladestation für Elektroautos gestört. Der Amerikaner sieht München in einer Vorreiterrolle und als Vorbild, dass es sich lohnt, den harten, aber sauberen Weg zu gehen.
Auch Fairey lässt den Vorwurf nicht zu, Autoritäten vereinnahmten Kunst für sich: „Je mehr Kunst im öffentlichen Raum ist – demokratisch und zugänglich – desto besser, weil es den Leuten andere Wege der Kommunikation zeigt.“ Viele Menschen sähen sich nur noch als Zuschauer*innen, deren Handeln keine Auswirkungen mehr habe. Kunst und Street-Art vermittelten hingegen, dass mehr möglich sei: „Kunst ist ermächtigend.“ Seinen Leitsatz schränkt er nur dahingehend ein, die Künstler*innen müssten jederzeit den Inhalt bestimmen.
 Pohl sieht es genauso, schließlich sei der Widerstand zu groß gewesen, als dass man sagen könne, München habe Street-Art bestellt. Ebenso gehe es nicht darum, Trends zu folgen, sondern der Öffentlichkeit Kunst zu ermöglichen, von der man sich inspirieren lassen kann. Nicht der Name des Künstlers, aber die Wirkung seiner Arbeit sei von Bedeutung. Fairey beschreibt die Ironie von Street-Art: „Früher wurde ich des Vandalismus beschuldigt, meine Werke würden den Wert von Grundstücken verringern. Plötzlich bin ich Teil von Gentrifizierung. Nur war es nie möglich, mich dazwischen zu bewegen.“
Pohl sieht es genauso, schließlich sei der Widerstand zu groß gewesen, als dass man sagen könne, München habe Street-Art bestellt. Ebenso gehe es nicht darum, Trends zu folgen, sondern der Öffentlichkeit Kunst zu ermöglichen, von der man sich inspirieren lassen kann. Nicht der Name des Künstlers, aber die Wirkung seiner Arbeit sei von Bedeutung. Fairey beschreibt die Ironie von Street-Art: „Früher wurde ich des Vandalismus beschuldigt, meine Werke würden den Wert von Grundstücken verringern. Plötzlich bin ich Teil von Gentrifizierung. Nur war es nie möglich, mich dazwischen zu bewegen.“
Aus künstlerischer Perspektive ändere sich nichts an der Absicht eines Werks, weil sich die Nachbarschaft verändere: „Kunst besteht auf ihre eigene Integrität.“ Er spricht nicht mehr mit den Worten eines Straßenkünstlers, der weder Interesse noch die Möglichkeit hat, mit seiner Kunst Geld zu verdienen. Die Popularität von Street-Art hat ihn in die Lage versetzt, einen Bewusstseinsprozess zwischen Kommerzialisierung und Authentizität an der eigenen Person zu erfahren.
Wie Fairey München erlebt hat
Dass Street-Art auf dem schmalen Grat zwischen Authentizität und Kommerzialisierung balanciert, spricht einer der berüchtigsten und bekanntesten Künstler der Szene an. Banksy hat 2008 in seinem Film „Exit through the Gift Shop“ den Aufstieg des besessenen Thierry Guetta vom Kunstschaffenden zum Kunstproduzierenden porträtiert.
Dessen Weg greift die Problematik von Kunst und Kommerz auf. Fairey spielt sich selbst und ist entsetzt von dem Monster, das sie geschaffen haben. Fairey, Banksy und andere sind im Film, der als fiktionale Dokumentation daherkommt, Freunde von Guetta und helfen ihm, seine künstlerischen Ambitionen umzusetzen. Ganz so wie Pohl es macht. Nur dass der keinen Bekannten einen Gefallen tut, sondern Künstler von Ruf und seine Stadt zusammenbringt. Er tut vor allem der Stadt einen Gefallen.
München ist für Fairey trotz seines kurzen Aufenthalts eine schöne Erfahrung gewesen: „Alle sind sehr freundlich und einladend.“ Er erzählt, wie sie vormittags noch ein Piece auf einem Laster gemalt haben. Der Besitzer sei sehr offen für die Idee und ein Kunstfan gewesen, alles ganz unkompliziert. Für eine große Tour hat die Zeit zwar nicht gereicht, aber dennoch hat er das ein oder andere Talent an den Wänden und gut gemachtes traditionelles Graffiti entdeckt.
Zum Staunen hat den Künstler ein elfjähriger Junge gebracht, der ihm sein Blackbook gezeigt hat. „Für sein Alter zeichnete er ziemlich gut und auch sein Stil war beeindruckend. Das sagt viel über die deutsche Präzision“, zwinkert er. Was Vorurteile über München angeht, hat sich Fairey an Biergärten abgearbeitet. Gleich zwei Besuche hat er untergebracht, er mag unser Essen, ist ein Biertrinker. Natürlich ist sein Blick vor allem auch auf die Straßen gefallen: „Sie sind ziemlich sauber. Die Leute scheinen die Gegenden, wo sie leben, sehr zu respektieren.“ Wir müssten nur aufpassen, die Stadt nicht zu steril werden zu lassen. Genau dafür war er ja auch hier, seine Fingernägel bezeugen das. München hat jetzt einen echten Fairey.
Fotocredit: © Lorraine Hellwig

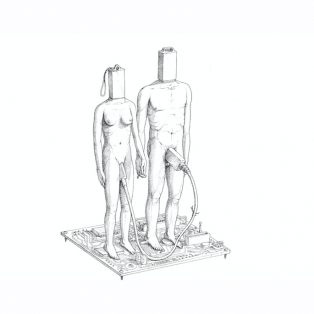


No Comments